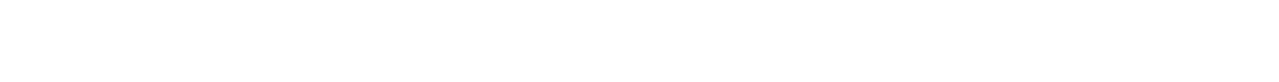
Bundestagswahl
Hier finden Sie Informationen zu Bundestagswahlen:
Wahltermin
Der Deutsche Bundestag wird alle vier Jahre in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.
Das Grundgesetz (Artikel 39 Absatz 1) gibt den Zeitrahmen vor, in dem eine Bundestagswahl stattfinden muss. Danach findet eine Neuwahl frühestens 46 und spätestens 48 Monate nach dem Beginn der jeweils laufenden Wahlperiode statt (das entspricht in der derzeitigen Wahlperiode der Zeitspanne von Mittwoch, dem 25. August 2021 bis Sonntag, dem 24. Oktober 2021). Kommt es zu einer vorzeitigen Beendigung der Wahlperiode des Bundestages, müssen vorgezogene Neuwahlen innerhalb von 60 Tagen nach der Auflösungsentscheidung stattfinden.
Der Wahltag muss ein Sonntag oder gesetzlicher Feiertag sein (§ 16 Bundeswahlgesetz). Dabei wird berücksichtigt, dass die Termine für Bundestagswahlen möglichst nicht mit den Hauptferienzeiten kollidieren.
Wahlgebiet
Das Bundesgebiet ist derzeit in 299 Wahlkreise eingeteilt. Die Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag ist in Anlage 2 zu Artikel 1 des Vierundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes (BWG) vom 25. Juni 2020 (BGBl. I S. 1409) beschrieben. Sie ist am 30. Juni 2020 in Kraft getreten. Auf das Land Brandenburg entfallen zehn Bundestagswahlkreise. Dabei handelt es sich um die Wahlkreise 56 bis 65.
Die Notwendigkeit der Neuabgrenzung einzelner Wahlkreise resultiert unter anderem aus der gesetzlichen Regelung des § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2, 3 und 5 BWG. Danach muss die Zahl der Wahlkreise in den einzelnen Ländern deren Bevölkerungsanteil soweit wie möglich entsprechen und die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises soll nicht mehr als 15 vom Hundert nach oben oder unten von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl der Wahlkreise abweichen. Beträgt die Abweichung mehr als 25 vom Hundert, ist eine Neuabgrenzung vorzunehmen. Maßgeblich hierfür ist die Zahl der deutschen Bevölkerung unabhängig von ihrem Alter. Bei der Einteilung sollen die Grenzen der Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte nach Möglichkeit eingehalten werden.
Information für Bewerbende
Die Teilnahme an Wahlen ist zentraler Bestandteil des in Artikel 38 Grundgesetz verankerten Wahlrechts. Sie ist nicht nur Kandidierenden von Parteien vorbehalten, sondern vielmehr können Wahlvorschläge auch von Einzelbewerbenden eingereicht werden. Was für Bewerbende für die Teilnahme an der Wahl zum Deutschen Bundestag zu beachten ist, wird im Folgenden dargestellt.
Wählbarkeit und Teilnahmeberechtigung
Wählbar sind Deutsche, die am Tag der Wahl 18 Jahre und älter sind und denen nicht die Wählbarkeit aberkannt wurde.
Wahlvorschläge können von Parteien und Einzelbewerbenden eingereicht werden. Parteien können an der Bundestagswahl mit eigenen Kreiswahlvorschlägen in den Wahlkreisen sowie mit eigenen Landeswahlvorschlägen (Landeslisten) in den Ländern teilnehmen. Eine Partei darf in jedem Land nur eine Landesliste einreichen. Landeslisten können nur von Parteien eingereicht werden. Einzelbewerbende können von Wahlberechtigten oder Wählergruppen vorgeschlagen werden und in einem (beliebigen) Wahlkreis in Deutschland kandidieren ohne dort einen Wohnsitz haben zu müssen.
Beteiligungsanzeige
Eine Beteiligungsanzeige ist die schriftliche Erklärung einer politischen Vereinigung, mit der sie ihre Absicht erklärt, an der bevorstehenden Bundestagswahl teilnehmen zu wollen. Politische Vereinigungen, die Wahlvorschläge einreichen möchten und die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, müssen dem Bundeswahlleiter spätestens am 97. Tag vor der Wahl bis 18 Uhr ihre Beteiligungsanzeige vorgelegt haben und damit die Entscheidung des Bundeswahlausschusses über ihre Parteieigenschaft herbeiführen.
In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen (einschließlich Kurzbezeichnung) sich die Partei an der Wahl beteiligen will. Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter der vorsitzenden Person oder der Stellvertretung, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle des Bundesvorstandes. Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes sind der Anzeige beizufügen. Der Anzeige sollen zudem Nachweise über die Parteieigenschaft nach § 2 Absatz 1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt werden.
Der Bundeswahlausschuss stellt spätestens am 79. Tag vor der Wahl fest, welche Vereinigungen für die Bundestagswahl als Parteien anzuerkennen und somit vorschlagsberechtigt sind.
Wahlvorschläge
Einzelbewerbende
Für die Nominierung von sich einzeln bewerbenden Personen sind keine Versammlungen und geheimen Abstimmungen vorgeschrieben. Lediglich drei unterzeichnende Personen haben ihre Unterschrift auf dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten. Weiter erforderlich ist die Beibringung von 200 Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten des Wahlkreises. Einzelbewerbende können in einem beliebigen Wahlkreis in Deutschland kandidieren ohne dort einen Wohnsitz haben zu müssen.
Parteibewerbende
Parteien müssen ihre Bewerbenden sowohl für die Kreiswahlvorschläge als auch die Landeslisten in einer Versammlung aufstellen (sogenannte Aufstellungsversammlung). Die Aufstellungsversammlung kann sein eine:
- Mitgliederversammlung: Versammlung der Mitglieder der Partei, die im Zeitpunkt ihres Zusammentritts bei Kreiswahlvorschlägen im Wahlkreis und bei Landeslisten im Land Brandenburg zum Deutschen Bundestag wahlberechtigt sind.
- besondere Vertreterversammlung: Versammlung der von einer Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte gewählten Vertretenden.
- allgemeine Vertreterversammlung: Versammlung von Vertretenden, die nach der Satzung der Partei (§ 6 des Parteiengesetzes) allgemein für bevorstehende Wahlen von einer Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte bestellt wurden.
Für das Aufstellungsverfahren von Parteibewerbenden gelten für Kreiswahlvorschläge und Landeslisten die gleichen Voraussetzungen:
- Als Bewerbende einer Partei kann nur benannt werden, wer nicht Mitglied einer anderen Partei ist.
- Bewerbende sowie und die Vertretende für die Vertreterversammlung dürfen bei Kreiswahlvorschlägen nur von den in dem jeweiligen Wahlkreis, bei Landeslisten nur von den in dem jeweiligen Land wahlberechtigten Parteimitgliedern gewählt werden.
- Die Wahl der Bewerbenden sowie der Vertretenden für die Vertreterversammlung erfolgt in geheimer Abstimmung.
- Jede stimmberechtigte teilnehmende Person der Versammlung ist vorschlagsberechtigt.
- In der Versammlung muss den Bewerbenden Gelegenheit gegeben werden, sich und ihr Programm in angemessener Zeit vorzustellen.
- Über die erfolgte Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen (Anlage 17 Bundeswahlordnung für Kreiswahlvorschläge und Anlage 23 Bundeswahlordnung für Landeslisten).
- Von der Versammlungsleitung sowie von zwei von der Versammlung Gewählten ist eine Versicherung an Eides statt über den ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung zu unterschreiben.
Unterstützungsunterschriften
Parteien, die seit deren letzter Wahl nicht im Deutschen Bundestag oder einem Landtag auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, sowie Einzelbewerbende benötigen bei Kreiswahlvorschlägen mindestens 200 Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten des jeweiligen Wahlkreises. Bei Landeslisten müssen diese Parteien mindestens 2000 Unterstützungsunterschriften sammeln.
Die Unterschriften haben jeweils persönlich und handschriftlich zu erfolgen. Die Unterschriften sind auf Formblättern zu leisten, die bei den zuständigen Kreiswahlleitungen bzw. bei der Landeswahlleitung erhältlich sind. Für jede unterzeichnende Person ist zudem eine Bescheinigung der Gemeindebehörde beizufügen, dass sie im Zeitpunkt der Unterzeichnung im Wahlkreis bzw. im Land Brandenburg wahlberechtigt ist. Jede wahlberechtigte Person darf nur einmal einen Kreiswahlvorschlag bzw. eine Landesliste unterstützen.
Unterstützungsunterschriften dürfen erst gesammelt werden, wenn der Wahlvorschlag aufgestellt ist. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig.
Ausgenommen von diesen Anforderungen sind Parteien nationaler Minderheiten.
Einzureichende Unterlagen
Kreiswahlvorschläge und Landeslisten sind bis zum 69. Tag vor der Wahl bis 18 Uhr bei der jeweils zuständigen Kreiswahlleitung bzw. der Landeswahlleitung einzureichen. Jede Partei darf in einem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag einreichen. Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen einer Person enthalten. Die sich bewerbende Person darf nur in einem Kreiswahlvorschlag und damit nur in einem Wahlkreis kandidieren.
Zur Einreichung eines Wahlvorschlags stellt die Bundeswahlleitung das Wahlvorschlagsportal "Kandidatenportal" zur Verfügung. Dieses Portal vereinfacht und beschleunigt die Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung der notwendigen Vordrucke eines Wahlvorschlags für die Bundestagswahl erheblich.
Die Vordrucke können bequem online ausgefüllt, verwaltet, heruntergeladen und ausgedruckt werden. Eine benutzerfreundliche Menüführung, ergänzende Hilfetexte sowie Zusatzfunktionen wie die Autovervollständigung von Adresseingaben unterstützen bei der Dateneingabe. Mehrfach benötigte Angaben müssen nur einmal eingegeben werden. Warnmeldungen und eine abschließende Plausibilitäts- und Vollständigkeitskontrolle weisen auf mögliche Unstimmigkeiten hin, sodass Fehleingaben überprüft und noch vor der Einreichung des Wahlvorschlags berichtigt werden können. Die im Portal eingegebenen Daten werden gespeichert, so dass die Arbeit jederzeit unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden kann. Wenn die Dateneingabe abgeschlossen ist, können die Formulare heruntergeladen und ausgedruckt werden. Nach dem Unterschreiben muss der Wahlvorschlag rechtzeitig bis zum Ablauf der Einreichungsfrist, also spätestens am 69. Tag vor der Wahl um 18:00 Uhr, schriftlich im Original bei der Landeswahlleitung für Brandenburg (Landesliste) bzw. bei der zuständigen Kreiswahlleitung (Kreiswahlvorschlag) eingereicht werden.
Sofern erforderlich, erhalten Sie nach Aufstellung des Wahlvorschlags das Formblatt Anlage 14 zur Bundeswahlordnung für eine Unterstützungsunterschrift für einen Kreiswahlvorschlag bei der zuständigen Kreiswahlleitung und/oder das Formblatt Anlage 21 zur Bundeswahlordnung für eine Unterstützungsunterschrift für eine Landesliste bei der Landeswahlleitung.
Zulassung der Kreiswahlvorschläge und der Landesliste
Die Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge trifft der Kreiswahlausschuss und über die Zulassung der Landeslisten der Landeswahlausschuss am 58. Tag vor der Wahl.
Information für wählende Personen
Wahlberechtigung
Wahlberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger, die am Wahltag
- Deutsche im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes sind,
- das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben,
- nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind und
- dessen gewöhnlicher Aufenthalt seit mindestens einem Monat im Land Brandenburg liegt. Bei Inhabern von Haupt- und Nebenwohnungen wird der gewöhnliche Aufenthalt am Ort der Hauptwohnung vermutet.
Wählerverzeichnis
Die Gemeindebehörden führen für jeden Wahlbezirk ein Verzeichnis, in dem alle Wahlberechtigten enthalten sind. Alle Wahlberechtigten haben das Recht, die zu ihnen eingetragenen Daten durch Einsichtnahme auf Korrektheit zu überprüfen. Der Zeitraum der Einsichtnahme sind die Werktage vom 20. bis zum 16. Tag vor der Wahl während der allgemeinen Öffnungszeiten. Die Einsichtnahme zur Überprüfung der Richtigkeit von Daten Dritter ist nur in bestimmten Ausnahmefällen möglich.
Wahlbenachrichtigung
Alle Wahlberechtigten, die in das Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis zum 21. Tag vor der Wahl eine Wahlbenachrichtigung. Wahlberechtigte, die bis zu diesem Zeitpunkt keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, sollten in der darauffolgenden Woche von ihrem Recht auf Einsichtnahme in das Wahlberechtigtenverzeichnis Gebrauch machen, um festzustellen, ob ihre Eintragungen korrekt sind. Bei festgestellten Unkorrektheiten kann innerhalb der Einsichtsfrist Einspruch erhoben werden. Kontaktieren Sie hierzu das Wahlbüro (Kontaktdaten vgl. seitliche Randspalte).
In der Wahlbenachrichtigung wird unter anderem über Folgendes informiert:
- in welchem Zeitraum die Wahl stattfindet,
- wo sich der Wahlraum befindet und ob er barrierefrei erreichbar ist,
- die Nummer der wahlberechtigten Person im Wahlberechtigtenverzeichnis,
- die Aufforderung den Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen,
- Erläuterungen zur Beantragung von Wahlscheinen, wenn zum Beispiel die Briefwahl gewünscht wird (ein Antrag befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung) sowie
- das Wählen von Personen mit einer Behinderung.
Briefwahl
Wer am Wahlsonntag nicht im Wahllokal wählen kann, hat die Möglichkeit per Briefwahl vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Ein Antrag auf Briefwahl befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Dieser Antrag ist in einem frankierten Briefumschlag an die angegebene Adresse der örtlichen Wahlbehörde zu senden. Der Antrag kann auch per E-Mail, Fax und in vielen Gemeinden auch online über die Webseite der Gemeinde gestellt werden. Eine telefonische Beantragung ist nicht möglich. In einem elektronisch gestellten Antrag ist neben der Angabe von Namen, Wohnadresse und gegebenenfalls einer Zustelladresse (zum Beispiel die Urlaubsadresse) auch das Geburtsdatum anzugeben.
Die Briefwahlunterlagen werden erst versendet, wenn die Stimmzettel gedruckt vorliegen. Das ist erfahrungsgemäß nicht vor dem 34. Tag vor der Wahl.
Wohnortwechsel
Bezieht eine wahlberechtigte Person, die schon in ein Wahlberechtigtenverzeichnis eintragen ist, nach dem 42. Tag vor der Wahl einen neuen Wohnsitz in einer anderen Gemeinde, so muss sie bis zum 21. Tag vor der Wahl bei der neuen Gemeinde einen Antrag auf Eintragung in das Wahlberechtigtenverzeichnis stellen. Bei einem Umzug innerhalb der Gemeinde verbleibt der Eintrag der wahlberechtigten Person im Wahlberechtigtenverzeichnis. Das bedeutet, dass diese wahlberechtigte Person nur im ursprünglichen Wahllokal wählen kann. Im ursprünglichen Wahllokal müssen auch alle wählen, die es nicht bis zum 21. Tag vor der Wahl geschafft haben, einen solchen Antrag auf Eintragung in das Wahlberechtigtenverzeichnis zu stellen oder die erst nach dem 21. Tag vor der Wahl in eine andere Gemeinde verziehen. In diesen Fällen empfiehlt es sich, im alten Wohnort die Briefwahl zu beantragen.
Deutsche im Ausland
Deutsche im Ausland sind wahlberechtigt, wenn sie
- 16 Jahre und älter sind,
- schon einmal mindestens 3 Monate in Deutschland gewohnt haben oder sehr stark mit Deutschland verbunden sind und
- die nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
Wer an der Bundestagswahl teilnehmen möchte und sich im Ausland befindet, muss bei der Gemeinde, bei der er früher gewohnt hat, einen Antrag auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis stellen. Wegen der langen Postwege, auch der zu versendenden Briefwahlunterlagen, sollte dieser Antrag frühzeitig gestellt werden. Er darf nicht nach dem 21. Tag vor der Wahl bei der Gemeinde eingehen. Die Anträge und das genaue Antragsverfahren finden Sie auf der Seite der Bundeswahlleitung.
Deutsche, die sich nur vorübergehend im Ausland befinden und in Deutschland gemeldet sind, werden von Amtswegen in das Wählerverzeichnis ihrer Gemeinde eingetragen. Sie können an der Briefwahl teilnehmen. Es empfiehlt sich auch hier wegen der langen Postwege, den Antrag auf Briefwahl frühzeitig bei der Gemeinde zu stellen.
Barrierefreies Wählen
Auf der Wahlbenachrichtigung ist vermerkt, ob das Wahllokal barrierefrei erreichbar ist. Ist das nicht der Fall, können Sie sich bei der Gemeinde nach dem nächstgelegenen barrierefreien Wahllokal in Ihrem Wahlkreis erkundigen. Mit einem Wahlschein, den Sie von der Wahlbehörde auf Antrag erhalten, können Sie in diesem Wahllokal an der Wahl teilnehmen. Es besteht auch die Möglichkeit der Briefwahl.
Blinde und sehbehinderte Menschen können mit einer Wahlschablone, in die der Stimmzettel eingelegt wird, an der Wahl teilnehmen. Die Stimmzettel sind für die Verwendung der Schablone mit ertastbaren Unterscheidungsmerkmalen versehen. Dazu wird die obere rechte Ecke der Stimmzettel entweder gekappt oder mit einem 5 mm großen Loch versehen. Dieses Merkmal dient den Blinden und Sehbehinderten allein zur Orientierung für die richtige Einlage des Stimmzettels in die Stimmzettelschablone und lassen keinerlei Rückschlüsse auf das Wahlverhalten der wählenden Person zu. Damit wird allen Sehbehinderten die Möglichkeit zur eigenständigen und geheimen Wahl gegeben.
Blinde oder sehbehinderte Wahlberechtigte erhalten diese Wahlschablone beim Blinden-und-Sehbehinderten-Verband Brandenburg e.V. unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Der Umgang mit der Wahlschablone wird auf einer mitgelieferten CD erläutert.
Blinden-und-Sehbehinderten-Verband Brandenburg e.V.
Straße der Jugend 114
03046 Cottbus
E-Mail: bsvb@bsvb.de
Telefon: 0355/22549
Fax: 0355/7293974
Internetseite: http://www.bsvb.de/
Repräsentative Wahlstatistik
Für die Bundestagswahl wird eine repräsentative Wahlstatistik erhoben. In einigen wenigen Wahlbezirken, die repräsentativ durch die Bundeswahlleitung ausgewählt wurden, werden Stimmzettel ausgegeben, die oben rechts einen Vermerk über das Geschlecht und die Altersgruppe der wählenden Person haben. Diese Unterscheidung dient ausschließlich der Auswertung für die repräsentative Wahlstatistik, die Aufschluss über das Wahlverhalten nach Alter und Geschlecht gibt. In der Wahlnacht werden diese Stimmzettel genauso wie alle anderen Stimmzettel ausgezählt. Für die Auszählung der Stimmen am Wahlabend haben diese Unterscheidungsmerkmale keinerlei Bedeutung. Die Wahlbezirke sind zudem so groß ausgewählt, dass das Wahl- und Statistikgeheimnis gewahrt bleibt. Später erfolgt durch das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg die Auswertung der Wahlergebnisse nach Geschlecht und Altersgruppen. Die hierzu notwendigen rechtlichen Grundlagen sind im Wahlstatistikgesetz geregelt.
In den betroffenen Wahllokalen wird auf die Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik hingewiesen. Personen, die per Brief wählen, erhalten zusätzlich ein Merkblatt mit den entsprechenden Erläuterungen.
Information für Wahlhelfende
Die Tätigkeit der Wahlhelfenden ist eine Grundvoraussetzung für die Durchführung von Wahlen. Gerade sie sorgen im Wahllokal für eine reibungslose und korrekte Abwicklung der Wahl. Nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr zählen sie die im Wahllokal abgegebenen Stimmen aus. Die Tätigkeit der Wahlhelfenden ist ehrenamtlich.
Wahlvorstand
Der Wahlvorstand in einem Wahllokal besteht aus fünf bis neun Personen:
- einer vorstehende Person,
- deren Stellvertretung,
- einer schriftführenden Person sowie
- zwei bis sechs weiteren Mitgliedern.
Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn während der Wahlhandlung von 8 bis 18 Uhr mindestens drei Wahlvorstandsmitglieder anwesend sind, darunter die vorstehende Person (oder deren Stellvertretung) und die schriftführende Person (oder deren Stellvertretung). Während der Auszählung der Stimmergebnisse nach 18 Uhr müssen alle Wahlvorstandsmitglieder anwesend sein. Die Mindestzahl beträgt dann fünf Wahlvorstandsmitglieder.
Aufgaben des Wahlvorstandes
Die vorstehende Person und deren Stellvertretung
- tragen die Verantwortung für die Tätigkeit des Wahlvorstandes,
- legen die Aufgaben für die einzelnen Wahlvorstandsmitglieder fest,
- übernehmen die Verpflichtung der Wahlvorstandsmitglieder zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit,
- treffen die abschließenden Absprachen mit der für das Gebäudemanagement zuständigen Person des Wahllokales und zur Öffnung des Wahllokales am Morgen des Wahltages,
- beaufsichtigen die ordnungsgemäße Stimmabgabe im Wahllokal und
- geben die Bereitschafts- und Schnellmeldungen an die Wahlbehörde durch.
Die schriftführende Person
- betreut das Wählerverzeichnis und prüft dabei die Wahlberechtigung der Wählenden und vermerkt die Stimmabgabe im Wählerverzeichnis,
- zählt bei Stimmenauszählung die Stimmabgabevermerke und
- füllt das Rechen- und Kontrollblatt sowie die Niederschrift und die Schnellmeldung aus.
Die übrigen Mitglieder
- geben die Stimmzettel aus,
- prüfen die Wahlberechtigung (Wahlbenachrichtigung und Personaldokument),
- sammeln abgegebene Wahlscheine,
- zählen die Stimmzettel mit aus und
- unterstützten die vorstehende Person bei der Beaufsichtigung der Wahlkabinen.
Berufung und Voraussetzungen für die Tätigkeit
Die Mitglieder der Wahlvorstände werden vor jeder Wahl von den Gemeindebehörden berufen. Sie sollen möglichst aus den Wahlberechtigten der Gemeinde, nach Möglichkeit aus den Wahlberechtigten des Wahlbezirks berufen werden. Bei Interesse wenden Sie sich daher bitte unmittelbar an Ihre Gemeinde. Kontaktdaten Ihrer Gemeinde finden Sie unter anderem auf service.brandenburg.de.
Mitglied des Wahlvorstands kann jede Person werden, die wahlberechtigt ist. Wahlbewerbende sowie ihre Vertrauenspersonen dürfen nicht in einem Wahlvorstand arbeiten.
Die Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Überprüfung der Wahlberechtigung, die Feststellung der Stimmabgabe sowie am Abend die Auszählung der Stimmen, erfordern ein konzentriertes und korrektes Arbeiten.
Erfrischungsgeld
Die Tätigkeit als Mitglied in einem Wahlvorstand ist ehrenamtlich. Sie wird also nicht vergütet. Es wird jedoch für den Einsatz ein Erfrischungsgeld gezahlt, dass bei der Bundestagswahl für die vorstehende Person 35 € und für die übrigen Wahlvorstandsmitglieder 25 € betragen kann.
Ablehnungsgründe
Die Mitglieder der Wahlvorstände üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Zur Übernahme dieses Ehrenamtes ist jede wahlberechtigte Person verpflichtet (§ 11 Bundeswahlgesetz). Die Übernahme eines Wahlehrenamtes kann jedoch gemäß § 9 Bundeswahlordnung abgelehnt werden, wenn die Person
- Mitglied der Bundesregierung oder einer Landesregierung ist,
- Mitglied des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestages oder eines Landtages ist,
- am Wahltage das 65. Lebensjahr vollendet hat,
- glaubhaft macht, dass ihr die Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes in besonderer Weise erschwert,
- glaubhaft macht, dass sie aus dringenden beruflichen Gründen oder durch Krankheit oder Behinderung oder aus einem sonstigen wichtigen Grunde gehindert sind, das Amt ordnungsmäßig auszuüben.
Termine und Fristen
Der über den unten stehenden Link gelangen Sie zu einem Zeitstrahl, der Ihnen die wichtigsten Termine und Fristen zu den Bundestagswahlen zeigt.
Zudem können Sie dort einen detaillierten Terminkalender mit allen Terminen und Fristen zur Bundestagswahl 2021 herunterladen.
Wesentliche Rechtsgrundlagen
Grundgesetz (GG)
Das Grundgesetz legt unter anderem die Rahmenbedingungen fest für die Gründung und Betätigung politischer Parteien (Artikel 9, 21 GG), die Wahl der Abgeordneten des Deutschen Bundestages (Artikel 38 GG), den Zusammentritt und die Wahlperiode des Deutschen Bundestages (Artikel 39 GG) und das Wahlprüfungsverfahren (Artikel 41 GG).
Bundeswahlgesetz (BWG)
Das Bundeswahlgesetz enthält die Vorschriften zum Verfahren bei Bundestagswahlen, insbesondere über das Wahlsystem, die Wahlorgane, das Wahlrecht sowie die Wählbarkeit, die Wahlhandlung und die Feststellung des Wahlergebnisses.
Bundeswahlordnung (BWO)
Die Bundeswahlordnung konkretisiert die Vorgaben des BWG. Sie enthält unter anderem Regelungen über die Bestellung und die Tätigkeit der Wahlorgane, die einzelnen Voraussetzungen für die Aufnahme in das Wählerverzeichnis, die Zulassung von Wahlvorschlägen, die Briefwahl, die Stimmabgabe im Wahllokal, die Auszählung der Stimmen bis hin zur Berufung der Gewählten.
Parteiengesetz (PartG)
Das Parteiengesetz enthält die näheren bundesgesetzlichen Regelungen des Parteienrechts, insbesondere über die verfassungsrechtliche Stellung und Aufgaben der Parteien sowie den Begriff der Partei. Darüber hinaus enthält es Vorschriften über einzelne Bereiche des Parteiwesens wie die Namensgebung und innere Ordnung der Parteien, die Gleichbehandlung, Grundsätze und Umfang der staatlichen Finanzierung, die Rechenschaftslegung und den Vollzug des Verbots verfassungswidriger Parteien.
Abgeordnetengesetz (AbgG)
Das Abgeordnetengesetz regelt die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages. Dazu gehören Regelungen zur Bewerbung um ein Mandat, zur Rechtsstellung der in den Bundestag gewählten Angehörigen des öffentlichen Dienstes, zu Leistungen an Abgeordnete und ehemalige Abgeordnete sowie zur Unabhängigkeit der Abgeordneten und zum Recht der Bundestagsfraktionen.
Wahlstatistikgesetz (WStatG)
Das Wahlstatistikgesetz ist Rechtsgrundlage für die Durchführung der allgemeinen und der repräsentativen Wahlstatistik bei der Wahl zum Deutschen Bundestag und bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland. Es regelt Maßnahmen zum Schutz des Wahl- und Statistikgeheimnisses bei der Auswertung von Stimmergebnissen nach Geschlecht und Altersgruppen in den repräsentativ ausgewählten Wahlbezirken.
Wahlprüfungsgesetz (WahlPrG)
Dieses Gesetz regelt das Verfahren, in dem über die Gültigkeit der Wahlen zum Deutschen Bundestag entschieden wird.
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Für die Organisation der Parteien als Verein finden die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs über Vereine in §§ 21 – 79 BGB Anwendung. Parteien sind in Deutschland in der Regel als nicht rechtsfähige, das heißt nicht eingetragene Vereine organisiert, zum Teil auch als eingetragene Vereine (e. V.).
Strafgesetzbuch (StGB)
Das Strafgesetzbuch enthält im vierten Abschnitt Regelungen zum Verlust der Amtsfähigkeit, der Wählbarkeit und des Stimmrechts infolge begangener Straftaten sowie zu Straftaten bei Wahlen und Abstimmungen.
Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG)
Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz enthält unter anderem Bestimmungen über die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts, das verfassungsgerichtliche Verfahren und einzelne Verfahrensarten. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet zum Beispiel über die Verfassungswidrigkeit von Parteien, über Beschwerden gegen Entscheidungen des Bundestages, die die Gültigkeit einer Bundestags- bzw. Europawahl betreffen und über Beschwerden von Vereinigungen gegen ihre Nichtanerkennung als Partei für die Wahl zum Bundestag.
Ergebnisse
Auf der Seite der Landeswahlleitung Brandenburg stehen die Ergebnisse der Kommunalwahlen zur Verfügung.
Auf der Seite des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg stehen die Ergebnisse zu den Europa-, Bundestags-, Landtags-, und Kommunalwahlen im Land Brandenburg, auch zum Download als Excel-Datei, zur Verfügung.
